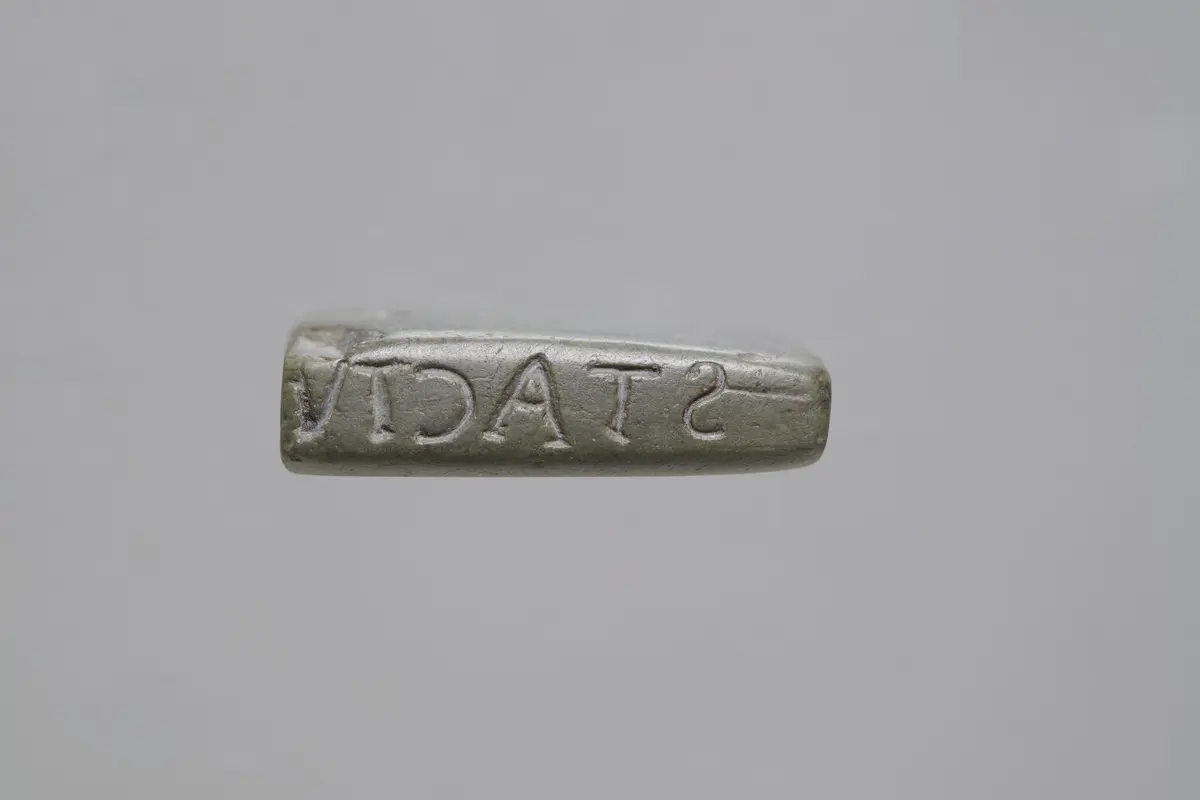Time:
2. - 4. Jh. n. Chr.
Object Name:
Augensalbenstempel (Augenarztstempel, Okulistenstempel)
Culture:
Römisch
Location of discovery:
Unbekannt
Material/technology:
Steatit, grün
Dimensions:
3,2 cm × 3,5 cm × 1 cm
Inscribed:
Transkription:
Seite a) GLY*PTI ←
Seite b) PSORIC̣(um) ←
Seite c) uacat
Seite d) STACTV(m) ←
Übersetzung:
a) Von Glyptus
b) Psoricum
c) [leer]
d) Stactum
(bei "stactum" und "psoricum" handelt es sich um aus Kupfer gewonnene Zutaten)
Transkription, Übersetzung und Anmerkung: Muriel Labonnelie, Université de Bourgogne, Juli 2024
Copyright:
Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung
Invs.:
Antikensammlung, III 182
Provenance:
unbekannt; 1816 vorhanden