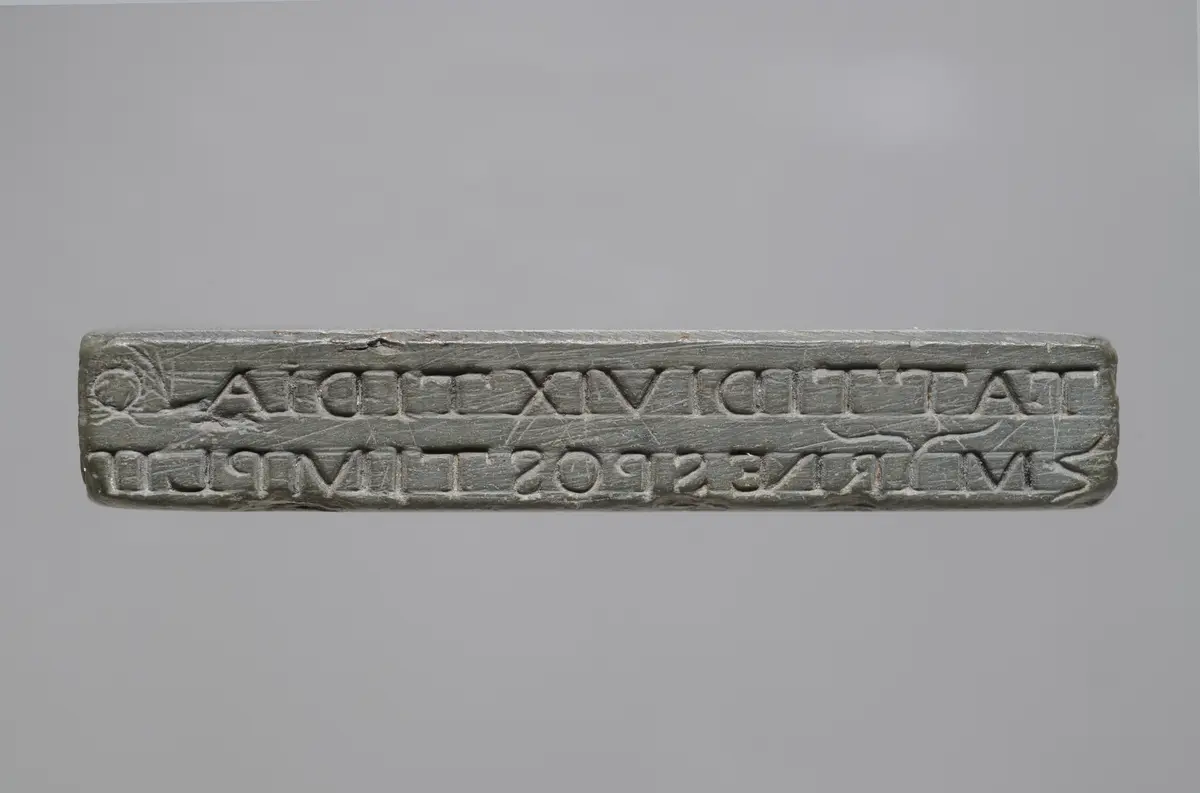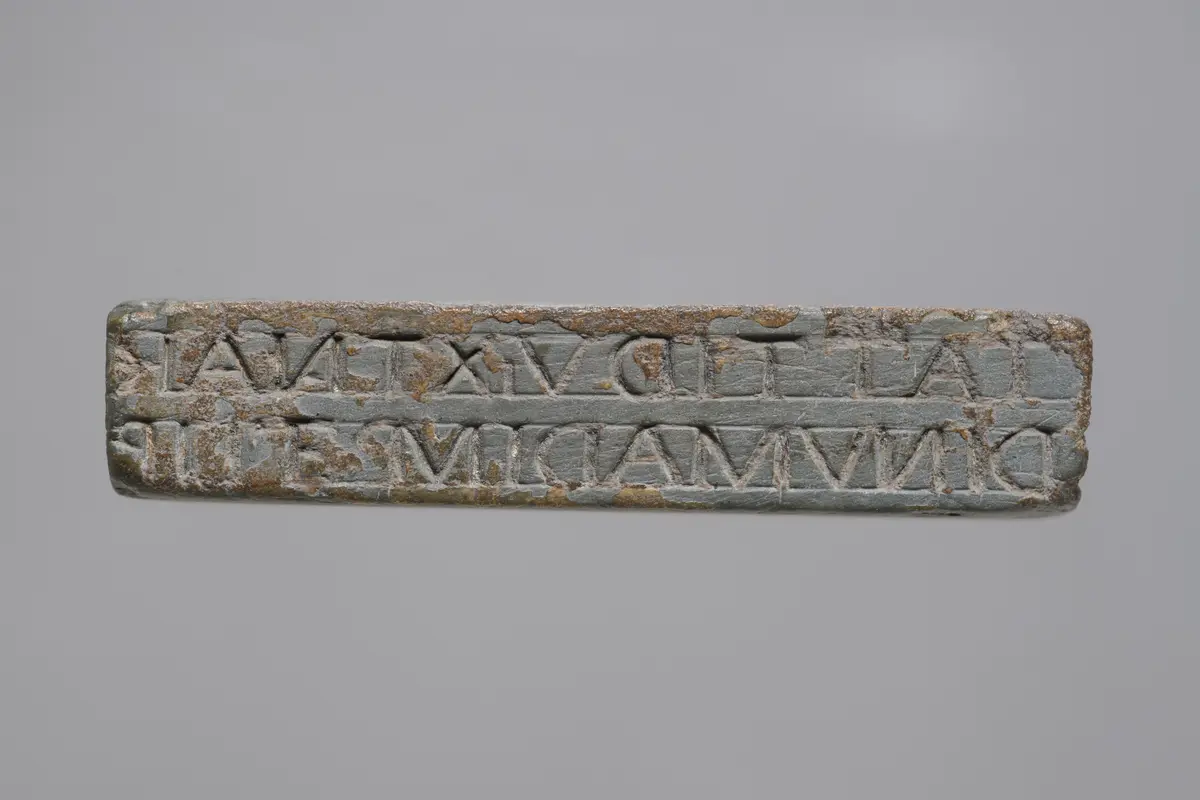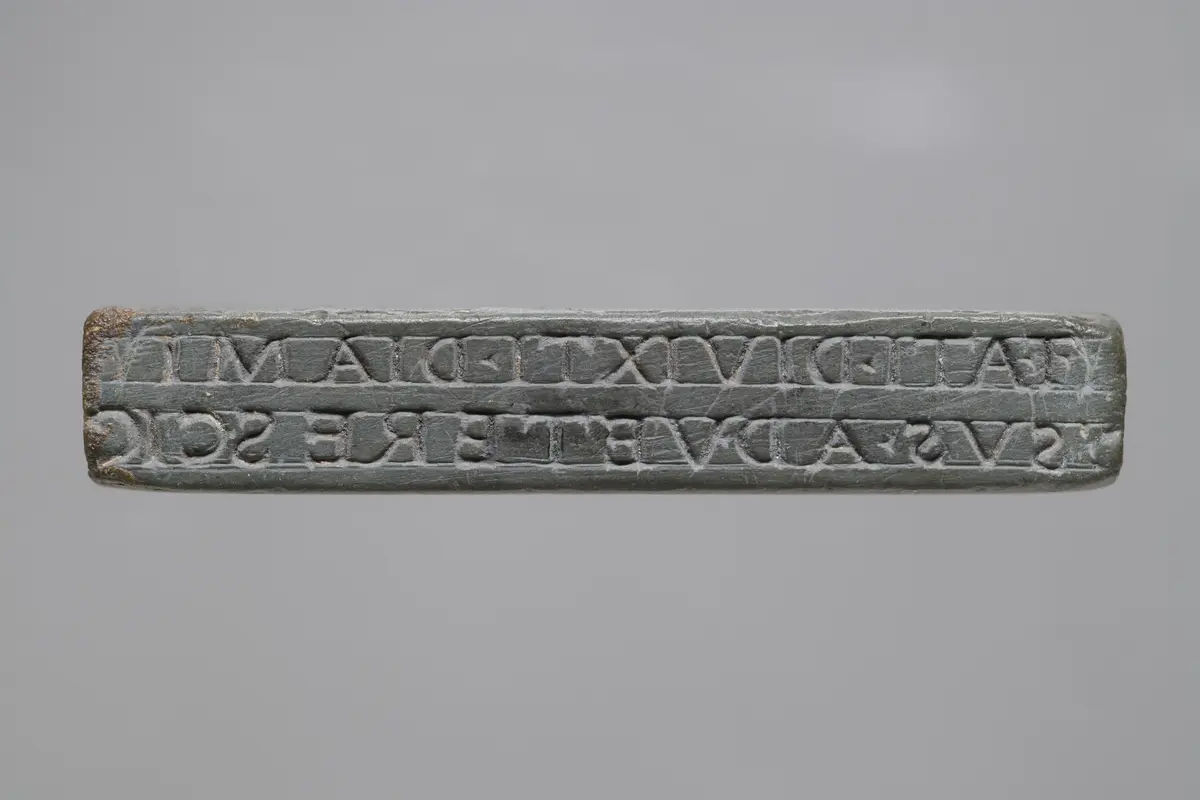Zeit:
2. - 4. Jh. n. Chr.
Objektbezeichnung:
Augensalbenstempel (Augenarztstempel, Okulistenstempel)
Kultur:
Römisch
Fundort:
Apulum (Alba Iulia, Karlsburg in Siebenbürgen, Rumänien)
Material/Technik:
Steatit, grün
Maße:
5,41 cm × 4,56 cm × 1 cm
Beschriftung:
Transkription:
Seite a) T(iti)*̣ ATTI DIVIXTI DIA* | ZMYRNES POST IMP(etum) LIP̣(pitudinis) ←
Seite b) Ṭ(iti) ATTI DVIXT(i) NAR | DINVM AD IMPẸṬ(um) ḶỊP̣(pitudinis) ←
Seite c) *T(iti)*ATI*DIVIXTI*DIAMI* | *SVS*AD*VETERES*CIC(atrices) ←
Seite d) *T(iti)*ATTI*DIVIXTI DIA | LIBANV(m) AD IMP(etum) EX OVO ←
Übersetzung:
a) Von Titus Attius Divixtus, auf Basis Myrrhe, nach dem Ausbruch der Augenerkrankung
b) Von Titus Attius Divixtus, mit Narde, für den Ausbruch der Augenerkrankung
c) Von Titus Attius Divixtus, auf Basis "misy", für chronische Narben
d) Von Titus Attius Divixtus, auf Basis Olibanum, für den Ausbruch, aus Ei
Transkription und Übersetzung: Muriel Labonnelie, Université de Bourgogne, Juli 2024
Bildrecht:
Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung
Inv. Nr.:
Antikensammlung, III 180
Provenienz:
Otvös, Dr. A.; Nuridsan J.; 1864 Kauf